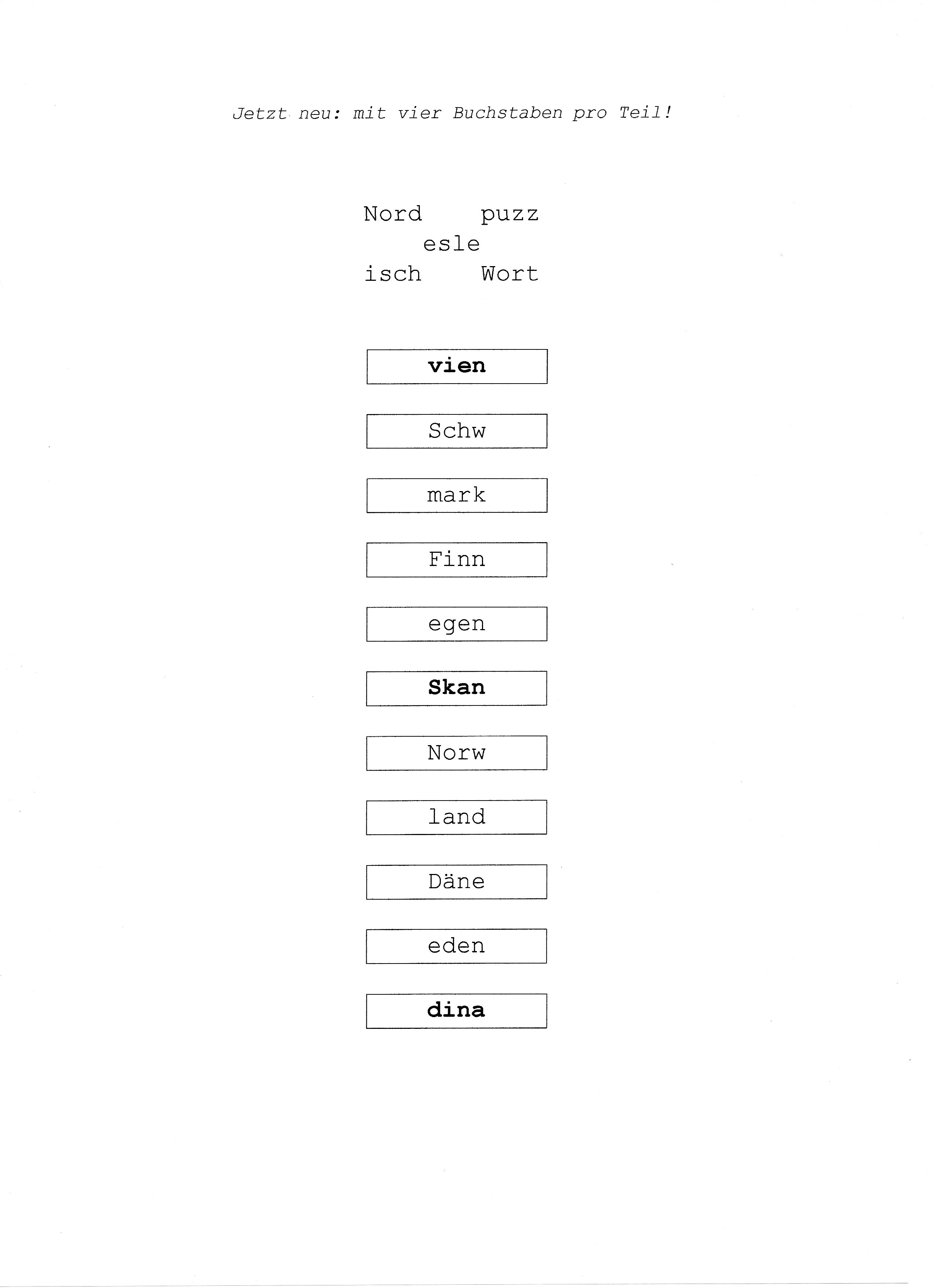Die Rollen in dem nun folgenden Schauspiel sind klar verteilt: Das Leben ist der Stierkampf, ich bin der Stierkämpfer. Um mich auf meine Rolle vorzubereiten, haben sie mir einen Holzverschlag gebaut. Sie sagen, ein Stier sei etwas Gefährliches. Wer sagt das? Die das sagen, sind das dieselben, die mir den Holzverschlag gebaut haben? Wollen die, die den Holzverschlag gebaut haben, mich beschützen vor dem Leben oder abhalten vom Leben? Habe ich den Holzverschlag selbst gebaut? So klar die Rollen sind, so unklar ist die Inszenierung.
Ich fühle mich nicht bereit für das Leben, denn sein Erscheinen als Stierkampf schüchtert mich ein, obwohl ich noch keinen Stier gesehen habe. Ich verkrieche mich hinter dem Holzverschlag. Es ist dunkel, nichts zu sehen, nur die Maserung des Holzes vor meinen Augen. Ich bekomme Angst. Bekomme ich Angst wegen dem Holzverschlag, weil durch ihn das Leben, das sich auf der anderen Seite befindet, eine unsichtbare Bedrohung wird? Oder hätte ich ohne den Holzverschlag noch viel mehr Angst? Ich stelle mir die bedrohlich schauenden Augen eines Stiers vor. Ich schmiege mich an das Holz. Ich rieche sein Aroma. Der Geruch betört mich. Ich vergesse das Leben, diesen bedrohlichen Stierkampf, so betört bin ich vom Geruch des Holzes. Ich bin Holzschnüffler statt Stierkämpfer, während auf der anderen Seite des Holzes das Leben weitergeht. Wie ist das Leben auf der anderen Seite des Holzes? Sind die Stiere schon wild, weil ich mich nicht zeige? Sie sagen, Stiere seien immer wild, zu allem bereit. Ich schnüffle weiter am Holz, um meine Angst zu bändigen. Ich glaube zu bemerken, dass ich, je länger ich am Holz schnüffle, desto weniger mit dem Leben zu tun habe. Trotzdem schnüffle ich wie ein Süchtiger am Holz herum. Deswegen schnüffle ich wie ein Süchtiger am Holz herum. In jedem Fall, ob trotzdem oder deswegen, schnüffle ich wie ein Süchtiger am Holz herum. Während meiner wilden Schnüfflerei ahne ich, dass das Leben weitergeht, auch wenn ich nichts mit ihm zu tun habe. Was passiert im Leben? Ich horche, eng an das Holz angeschmiegt. Ich höre Geräusche, die ich nicht einordnen kann. Sind die Stiere wild geworden? Meine Gedanken spielen verrückt. Die Angst kommt wieder, wie ein Blitz durchzuckt sie meinen Körper. Angestrengt horche ich weiter. Alles was ich höre beunruhigt mich. Der Geruch des Holzes, er betört nicht mehr, er ist nur noch schal.
Ich erinnere mich an die Rolle des Lebens: ein Stierkampf. Wenn das Leben ein Stierkampf ist, was ist die Rolle der Stiere in diesem Schauspiel? Sind sie wirklich nur die blutrünstige Fassade, der ich hilflos ausgeliefert bin? Ich sehe die kraftvollen, bulligen Stiere vor meinem geistigen Auge. Ich spüre ihre Kraft, obwohl ich noch nie einen Stier gesehen habe. Ich rieche das Holz nicht mehr. Stattdessen rieche ich Schweiß, Fleisch und Blut, und ehe ich denke, dass ich jetzt wohl mitten im Leben bin, birst das Holz in Stücke. Ein heftiger Einschlag des Lebens, der so nicht im Drehbuch stand.
Ich lebe, trotz dieses Einschlags, das ist erstaunlich. Ich überlege: Es war ein Einschlag des Lebens, denn ich lebe. Wäre ich tot, hätte diesen Einschlag wohl der Tod verursacht. Es war ein Einschlag des Lebens, was jeder Logiker mir wohl bestätigen würde. Der Geruch des Holzes kommt mir wieder in den Sinn, doch ich verfolge ihn nicht weiter. Stattdessen folge ich dem Geruch von Schweiß, Fleisch und Blut. Die Stiere galoppieren herum, und ich bin mitten im Leben, was im Drehbuch wiederum so vorgesehen war. Ich stolpere beinahe über eines der herumliegenden Holzstücke, und ehe ich weiter denken kann, was jetzt wohl geschieht, springe ich geistesgegenwärtig auf einen Stier, halte mich an seinen Hörnern fest und galoppiere mit ihm davon. Ich glaube zu träumen, aber es ist tatsächlich so: Ich sitze auf einem wild galoppierenden Stier. Ist das der Stierkampf des Lebens? Schneller, immer schneller galoppiert der Stier. Die Geschwindigkeit betört mich, wie mich vorhin der Geruch des Holzes betört hat. Doch das ist eine unzureichende Analogie. Der Stier ist mein Freund, er trägt mich durchs Leben. Wie kann das Leben ein Stierkampf sein, wenn der Stier mein Freund ist? Sind die Rollen klar verteilt? Jetzt, wo alles klar ist, ist alles unklar. Die Inszenierung des Lebens nimmt ihren Lauf.