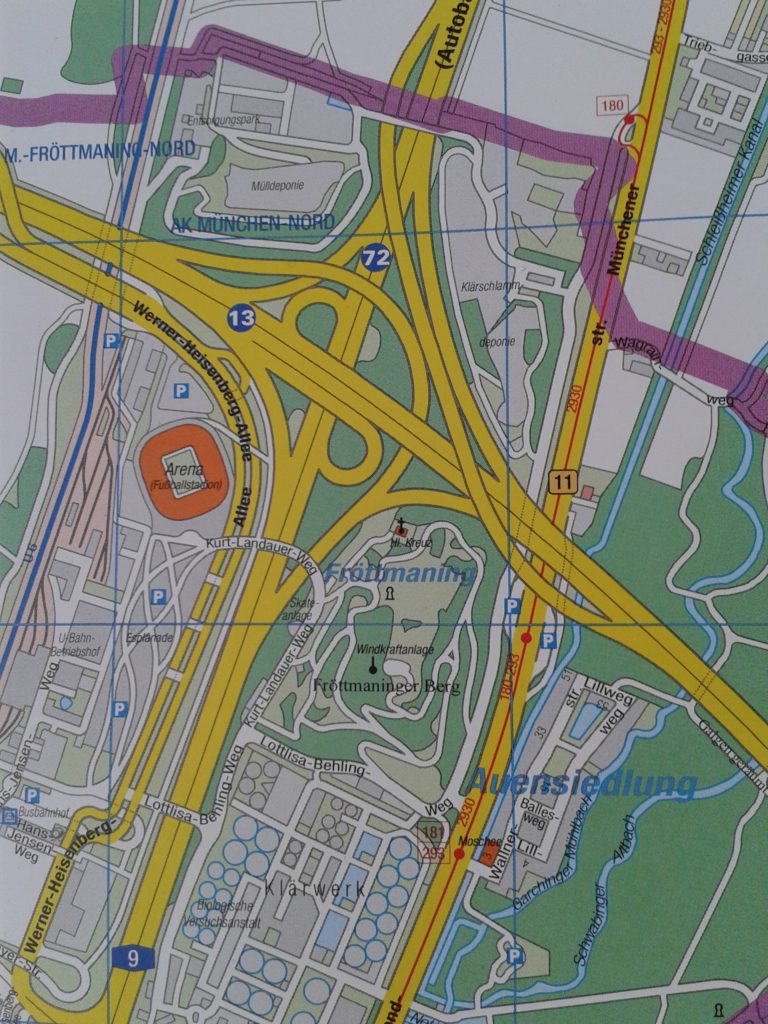Manchmal habe ich das Gefühl, Vorderbrandner besser zu kennen als mich selbst. Das kommt wahrscheinlich daher, dass ich durch Vorderbrandner mich selbst besser kennen lerne. Vorderbrandner trägt eine Art heiligen Zorn in sich, der sich von Zeit zu Zeit in Provokationen gegenüber Menschen entlädt, die gerade in seiner Nähe sind.
Wir waren im Park. Ich erzählte Vorderbrandner von meinem Entschluss, künftig keine Sonnencremes unter Lichtschutzfaktor 30 mehr zu verwenden. Vermutlich langweilten Vorderbrandner meine Ausführungen, denn ich spürte, wie ich seine Aufmerksamkeit verlor. Jedenfalls sprach Vorderbrandner unvermittelt einen uns entgegenkommenden Hundebesitzer an und fragte ihn, ob er Kotbeutel für seinen Hund dabei hat und ob er ihm einen abgeben könne. Der Hundebesitzer bejahte, gab Vorderbrandner einen Beutel und wollte weitergehen.
„Nein, warten Sie!“ sagte Vorderbrandner. „Ich werde gleich kacken und Ihnen den gefüllten Beutel wieder mitgeben!“ Der Hundebesitzer blickte irritiert, während Vorderbrandner seine Hosen runterzog und sich in Hockstellung begab.
„Sie werden doch nicht allen Ernstes hier hinmachen!“ rief der Hundebesitzer empört.
„Wieso denn nicht? Ihr Hund macht das doch auch! Seien Sie unbesorgt. Ich habe ausgewogen gegessen und fühle mich gut. Es wird keine Durchfallsauerei geben!“ Vorderbrandner drückte eine Wurst von mittelfester Konsistenz aus seinem Darm, die ins Gras fiel. Ein Stuhl, den jeder Arzt wohlwollend betrachten würde, weil er von gutem Stoffwechsel und Gesundheit zeugt.
Der Hundebesitzer wandte sich ab, rief seinen Hund und wollte weitergehen. Doch sein Hund kam nicht, was ihn zum Verweilen zwang. Auf der Wiese neben uns scheuchte ein großer Afghanischer Windhund in flottem Tempo Krähen aus dem Gras. An der Gestik des Hundebesitzers konnte ich erkennen, dass es sein Hund war.
Als der Windhund endlich auf die Rufe seines Besitzers hörte und zu diesem kam, hatte Vorderbrandner sein produziertes Häufchen in den Beutel eingetütet, das Taschentuch, mit dem er sich abgewischt hatte, dazugeworfen, und den Beutel mit einem Knoten verschlossen. Der Hundebesitzer hatte sich bereits einige Schritte entfernt. Vorderbrandner lief ihm nach und wollte ihm den Beutel überreichen. Der Hundebesitzer ignorierte Vorderbrandner, doch Vorderbrandner ließ nicht locker, sodass der Hundebesitzer schließlich entnervt stehenblieb, sich zu ihm wandte und sagte: „Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich Ihre Scheiße entsorge!“
„Doch, das glaube ich! Sie entsorgen doch die Scheiße Ihres Hundes auch. So groß wie der ist, glaube ich nicht, dass seine Scheiße leichter und weniger geruchsintensiv ist als meine.“
„Lassen Sie mich in Frieden!“ rief der Hundebesitzer, während sein Afghane schon wieder in vollem Tempo die Krähen im Gras scheuchte. In diesem Moment schlug Vorderbrandners Provokationslust in Zorn um, und er schrie erbost: „Du elender, hundebesitzender, tierquälender Stadtneurotiker, der seinen Hund mit seinen Neurosen zuscheißt und als Dank dessen Scheiße im Beutel herumträgt! Glaub ja nicht, dass ich dir jemals einen Beutel leihe, wenn du dringend kacken musst! Gib deinen entarteten, ungehaltenen, neurotisierten Köter sofort an die Leine, sonst ruf ich die Polizei!“
Während der Hundebesitzer unbeirrt, ohne sich noch einmal umzudrehen, sich von uns entfernte, sein Afghane es aufgab, die erbosten Krähen zu scheuchen und ihm nachlief, ritten in unserer Nähe zwei Polizisten auf Pferden vorbei. Vorderbrandner rief sie entgegen seiner Ankündigung nicht. Stattdessen ging er mit seinem Beutel in der Hand zum Bach, um sich dort zu waschen. Ich folgte ihm. Als ich ihn erreicht hatte, drehte er sich um und sagte: „Ich verwende gar keine Sonnencremes. Ich habe das Gefühl, dass ich mit diesem Zeug nur meine Haut malträtiere.“