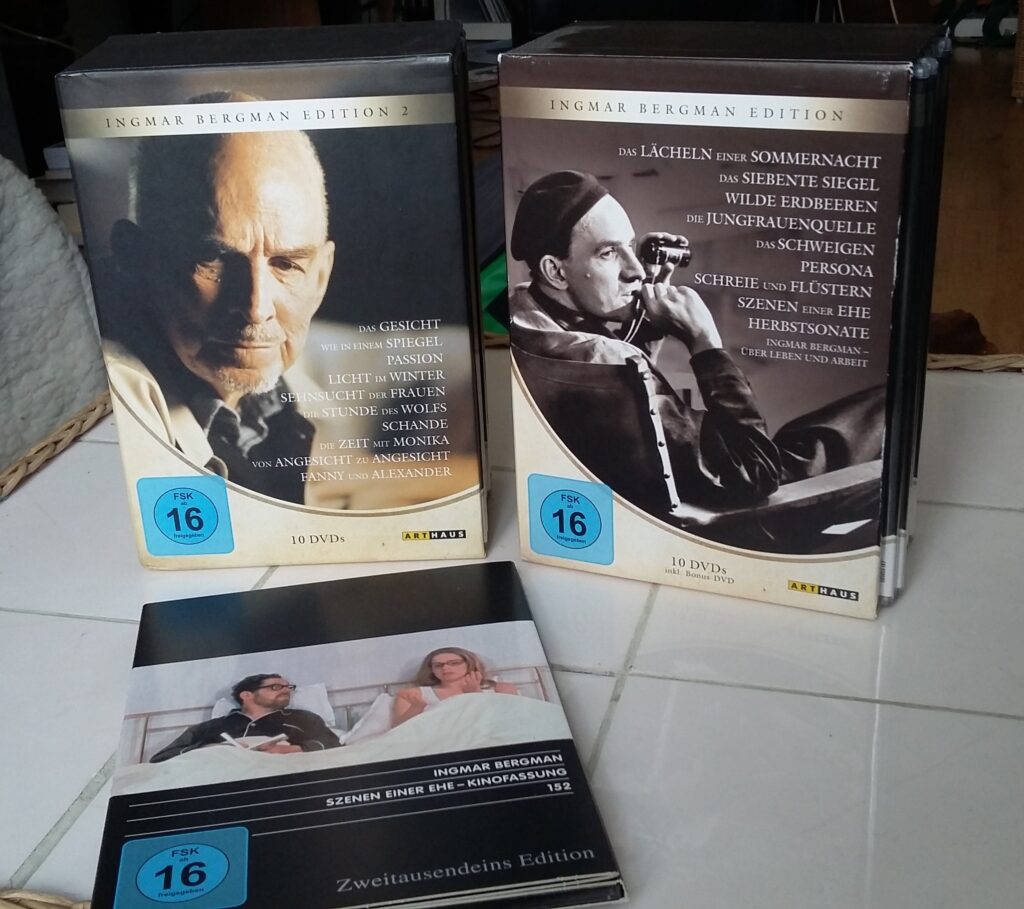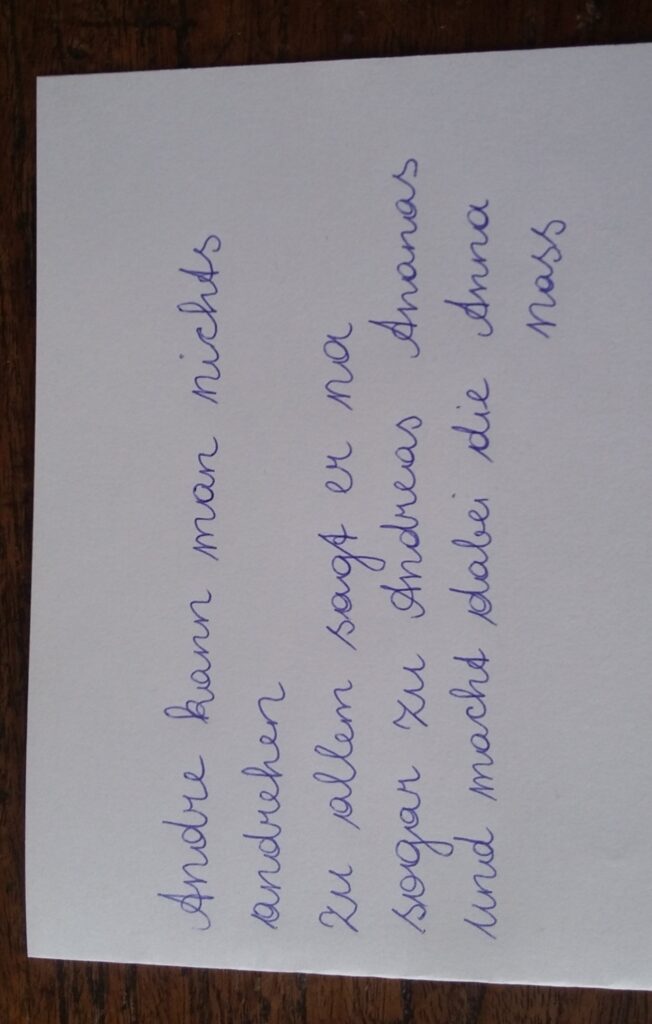1 Die Armseligkeit der Sprache
Uteto Fritz, der sich selbst als Künstler und Psychologen bezeichnet, hat bis vor kurzem eine Praxis für Sprachenergetik betrieben, eine Praxis, in der er sich mit der Energetisierung von Körper und Geist, von Leib und Seele mittels Sprache beschäftigte, doch Uteto Fritz hat diese Praxis beendet mit der Begründung, dass nur noch Dogmatiker zu ihm gekommen wären, also Leute, die die Energetisierung mittels Sprache zu ihrem einzigen Lebenszweck erklärt hätten, die dadurch aber keinen Schritt weitergekommen wären, während er andere, die durch Sprachenergetisierung vielleicht weitergekommen wären, nicht erreichte, er glaubt nicht mehr an die Kraft der Sprache, im Gegenteil, sagt Uteto Fritz, er bekam das Gefühl, dass Sprache den Zugang zu vielem, was uns als Menschen ausmacht, erschwert oder gar verbaut, und deshalb war es nur konsequent, meine Tätigkeit als Sprachenergetiker zu beenden, ich kann es mir leisten, sagt Uteto Fritz, ich bin nicht nur Künstler und Psychologe, sondern auch Erbe, mein Erwerbsdruck ist dadurch geringer, ich habe Zeit in meinem Leben, in der ich mich selbst und die Menschen beobachten kann, ich bekomme zwar immer noch Anfragen für sprachenergetische Sitzungen, aber es wäre verlogen, mich für diese Sitzungen bereitzustellen, Geld zu nehmen für die Sprachenergetisierung, wenn ich selbst nicht davon überzeugt bin, mittels Sprache energetisieren zu können, manche sagen zwar, die ganze moderne Dienstleistungsgesellschaft basiert auf Verlogenheit, ohne Verlogenheit kann man heutzutage kein Geld verdienen, aber ich will mich dieser Verlogenheit entziehen, indem ich nicht mehr als Sprachenergetiker arbeite, vielleicht kam mir die Pandemie dabei zu Hilfe, ich darf ja im Moment nicht als Sprachenergetiker arbeiten, zumindest nicht in persönlichem Kontakt, und über Video kann ich es nicht, da geht mir etwas verloren, vielleicht war das mein größter Irrtum, dass ich glaubte, die Sprache hätte heilende Wirkung, aber nur die Begegnung hat heilende Wirkung, die Begegnung auf allen Ebenen, körperlich-geistig-seelisch, die ja letztlich unvermeidlich ist, Leben bedeutet immer Begegnung, ein Sichöffnen für Begegnung, und weil wir Menschen sind, geht Begegnung leichter durch körperliche Präsenz, durch Hosen-runter-lassen im wahrsten Sinn der Worte, sich hingeben mit all seiner körperlichen Verletzlichkeit, um den Geist und die Seele zu öffnen, nur das hilft auf dem Weg zur Begegnung, vielleicht ist Sprache ein kleines Hinweisschild auf diesem Weg zur Begegnung, aber niemals Selbstzweck, niemals Allheilmittel, nein, Sprache ist ein armseliges Vehikel auf dem Weg zu den Geheimnissen der Menschheit, sagt Uteto Fritz.
weiter zu Teil 2