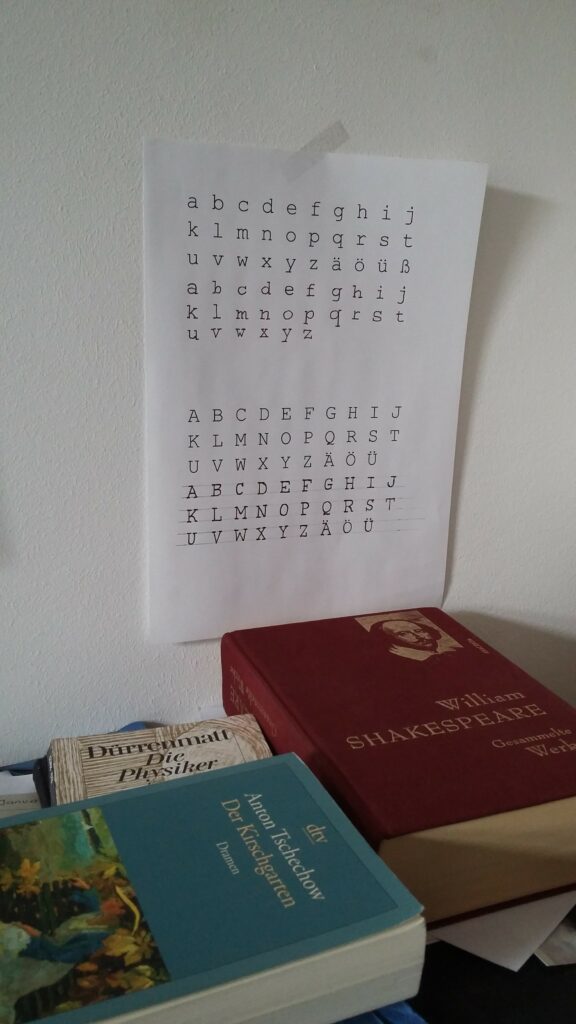Zunächst sei Folgendes erwähnt: Ein Virus kam um die Ecke und wollte Infi zieren, doch Infi zierte sich, sich mit dem Virus zu zieren. Das kann man als Wortspiel ohne Sinn abtun, da Infi gar nicht Infi, sondern Infidelia heißt, womit das Wortspiel mit infizieren gar nicht mehr möglich ist, worauf sich Infi meldete und meinte, ein Virus könne sie ruhig zieren, weil sie sich ohnehin krank fühlt, seit ihrer Geburt sei sie ein krankes, moralisch verwerfliches Wesen. Ihre Mutter, sagt Infi, bezeichnet sich selbst als eine Hure, ihre Mutter sagt, Hure bedeute lieb und begehrlich, was für sie als Frau ein großes Kompliment sei, deshalb habe sie beschlossen, sich selbst als Hure, Infis Bruder als Hurensohn und Infi als Hurentochter zu bezeichnen. Ich, sagt Infi jedenfalls, bin aus einer Affäre meiner Mutter mit einem Engländer entstanden, der kurz nach meiner Zeugung zu meiner Mutter sagte: Your infidelity makes me sick, I don’t want to see you anymore! Meine Mutter sagt, das gefiel ihr, dass ihn ihre Untreue, ihre Infidelity, krank machte, denn Krankheit sei das Ehrlichste was es gibt, zu ehrlich, um geliebt zu werden, aber gerade deswegen liebe sie sie. Einmal hatte meine Mutter heftige Zahnschmerzen, erinnert sich Infi, und sie sagte: Danke Welt, dass du mich erinnerst, dass ich ein kleiner Mensch bin, der nicht so verbissen sein sollte!
Meine Mutter wollte mich Huora nennen, sagt Infi, nannte mich dann aber Infidelia, aufgrund der Aussage des Engländers, meines Vaters. Lange wollte ich Fidelia heißen, denn durch die Hurerei meiner Mutter erschien mir Treue als etwas sehr Erstrebenswertes. Außerdem bedeutet fidel in der deutschen Sprache nicht vorrangig treu, sondern vor allem lustig und vergnügt. Eine meiner liebsten Weisen lautet: Ich bin fidel, ich bin fidel, bis dass der Teufel holt meine arme Seel.
Als ich das meiner Mutter vorspielte, war sie kurz am Hadern, ob sie mich nicht doch Fidelia hätte nennen sollen. Oder Fidelia Huora, meinte sie in ihrer Euphorie: Was für ein wundervoller Doppelname!
Mittlerweile bin ich jedoch sehr zufrieden mit meinem Namen, weiß ich doch, dass die Untreue die Treue, der Kummer die Vergnügtheit, die Krankheit die Gesundheit einschließt und umgekehrt, weiß ich doch, dass das Leben alles einschließt, weshalb ich es leben will bis zum Tod.